 |
In Deutschland wurden ab der Mitte des 19.
Jahrhunderts die meisten Güter auf der Schiene befördert. Die einzige
Konkurrenz waren Schiffe, aber das Netz der Wasserstraßen sehr
grobmaschig. Was keinen ganzen Güterwagen füllte, wurde von der
Reichsbahn als „Stückgut“ mit anderen Waren zusammen geladen oder als
„Gepäck und Expressgut“ in Personenzügen befördert. Die Reichspost bot
zwar bis etwa 30 kg Briefe und Pakete als Konkurrenz an – aber auch die
erreichten ihr Ziel in speziellen Bahnpostwagen auf der Schiene.
Bis 1930 entstanden in Deutschland 65 riesige,
400 Meter lange Stückgut-Umladehallen. In diesen ent- und beluden viele
Arbeiter mit wenigen einfachen Hilfsmitteln (wie z.B. Sackkarren) die
Güterwagen. Der Umschlag war daher zeitaufwändig und anfällig für
Fehlverladungen, Diebstahl und Beschädigungen. Der Transport dauerte oft
mehrere Tage, weil die Maschinen, Kisten oder Gebinde an mehreren
Bahnhöfen umgeladen wurden.
|
 
|

Abbildung aus einem Kundenbrief der
Deutschen Bundesbahn von 1967. |
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg automatisierte
die Deutsche Bundesbahn nur wenig. Die immer mehr werdenden
Speditionen nutzten hingegen den stetigen Fortschritt beim LKW-Bau.
Motorisierte Ladehilfen und elektronische Geräte im Fahrerhaus
erleichterten die Überwachung der Ladung und die Kommunikation mit der
Firmenzentrale.
Die Bundesbahn reagierte darauf mit Einschrän-kungen und der
Konzentration auf die Transporte zwischen den großen Städten.
|
|
Ab 1970 verringerte sie die Zahl der
Stückgutbahnhöfe und –umladestellen und arbeitete bei der
Ver-teilung in der Fläche mit örtlichen Speditionen zusammen. Dem
starken Konkurrenzdruck des internatio-nalen LKW-Verkehrs war sie aber
immer weniger gewachsen und beendete 1998 bundesweit den Trans-port
aller „Kleingüter“ auf der Schiene. Eine mengenmäßig sehr kleine
Ausnahme ist das „IC-Kuriergut“.
Der Rückzug von der Beförderung fast aller
Güter, die nicht mindestens einen Güterwagen füllen, schränkt die
Marktchancen der Bahn stark ein: Im Jahr 2001 wurden
bundesweit knapp 250 Millionen LKW-Fahrten durchgeführt, davon
enthielten 66 Millionen Fahrten (26%) eine Ladung unter 10 Tonnen. Auf
der Schiene wurde davon nur noch ein kleiner Bruchteil als
Sammeltransport der Deutschen Post und anderer Speditionen befördert.
Die Tatsache, dass ein 20-Fuß-Container etwas
kleiner als ein 2-achsiger Güterwagen ist, öffnet das Bahn-angebot schon
ein Stück weit für kleinere Frachten: das Gewicht oder Volumen, ab dem
die Bahn als Alternative zum LKW in Betracht kommt, sinkt um etwa 20 %.
Statt zurzeit 5 Tonnen für Wagenladungen kann es sich für einen
20-Fuß-Container schon ab 3 oder 4 Tonnen lohnen, die Fracht per Bahn zu
versenden.
|
|
Zudem besteht die
Möglichkeit, das Bahnangebot „nach unten“ mit „Kleincontainern“
abzurunden. Recht einfach wäre das durch die Erweiterung der
Containerstaffelungen (bislang mit Längen von 40, 30 und 20 Fuß) um
einen „10-Füßer“. Container in diesem etwa 3 Meter langen Format gibt es
bereits, bislang werden sie aber nur selten (z.B. von Möbelspeditionen)
eingesetzt. Auf der Schiene ist dem Autor nur eine Anwendung bekannt,
nämlich der “Touareg-Express“: Dieser Güterzug befördert in
10-Fuß-Containern auf Tragwagen der Gattung „Laas“ Karosserieteile für
den Volkswagen-Geländewagen „Touareg“ aus Österreich in die Slowakei.
Dank der bewährten
„Quick-Tie“-Beschläge kann man zwei
10-Fuß-Container fest miteinander verbin-den und wie einen „20-Füßer“
umladen und stapeln.
|
 |
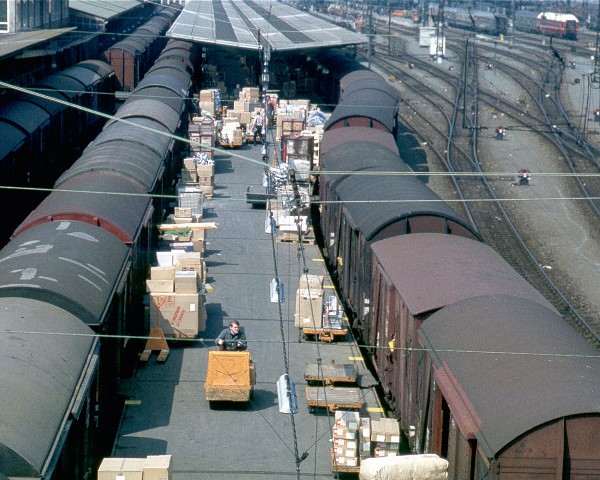
Das Bild vom Würzburger Hauptbahnhof lässt
erahnen, wie personalaufwändig der Stückgutverkehr bei der Bun-desbahn
in den 1970er Jahren noch war. (© A.
Wagner) |
|
Es geht also keine Zeit verloren und die
Leistungsfähigkeit der Terminals wird nicht beeinträchtigt. Mit den
Linienzügen der Bahn als Katalysator ist es durchaus denkbar, dass sich
der 10-Fuß-Container als weiterer Standard etabliert. Das könnte
wiederum zur Renaissance des „klassischen Stückgut verkehrs“ auf der
Schiene beitragen, da die Mindestfracht zur „Abfertigung“ eines
Containers sinkt. Die etwa 50 CEC-Bahnhöfe in Deutschland, zwischen
denen es stündlich schnelle Containerverbindungen geben soll, sind für
eine erste Stückgut-Ausbaustufe prädestiniert: Auch mit den
unvermeidlichen Zeitverlusten für das Umladen auf den LKW, mit dem die
Fracht Versender und Empfänger auf der Straße erreicht, können im
CEC‑Netz mit der Straße konkurrenzfähige Transportzeiten erreicht
werden. Auf lange Sicht ist natürlich eine größere Anzahl
schienenbedienter Stückgutbahnhöfe wünschenswert, um die Vor- und
Nachlaufstrecken auf der Straße zu reduzieren.
Zum Gepäck- und Expressgutverkehr werden im
Rahmen dieses Konzepts keine Aussagen getroffen. Es sei nur erwähnt,
dass die Zahl der Anbieter in diesem Gewichtssegment nach der Freigabe
des Postmonopols stark angestiegen ist. Das hat insbesondere in den
Großstädten zu einer sprunghaften Zunahme des Zustellverkehrs geführt.
Einige Städte versuchen inzwischen mühsam gegenzusteuern, indem sie die
verschiedenen Lieferungen koordinieren und gemeinsam zustellen lassen.
Es stellt sich die Frage, ob die dabei investierten Steuermittel nicht
besser investiert gewesen wären, wenn man sich früher über nachhaltige
Konzepte Gedanken gemacht hätte.
Immerhin kann es künftig
in den „Logistik-Zentren“ an den Rändern der Großstädte passieren, dass
viele kleine Kurier-Transporter ihre Fracht abliefern. Dort wird sie
sortiert, neu verteilt und dann in mehreren großen LKWs auf der Autobahn
in die Nachbarstädte gekarrt. Das wäre doch eigentlich ein klassischer
„Bahn-Sammelverkehr“ für einen CEC- oder CIR-Bahnhof
!
|